Eine Amputation ist ein gravierender Einschnitt in das Leben eines Menschen, sowohl körperlich als auch psychisch. In den letzten Jahren hat die Zahl der Selbsthilfeinitiativen für Menschen mit Amputationen sprunghaft zugenommen. Die Bedeutung psychischer und sozialer Faktoren bei der Bewältigung einer Amputation wird demzufolge auch von den Betroffenen selber als zunehmend wichtig wahrgenommen.
Die Rolle der Psyche bei der Bewältigung einer Amputation
Psyche – Was ist das?
Die sog. `Psyche´ ist dem wissenschaftlichen Fach Psychologie zuzuordnen und kann als Lehre vom Erleben und Verhalten des Menschen definiert werden. Dabei kann grob zwischen
1 Denken,
2 Fühlen (Emotionen) und
3 Verhalten
unterschieden werden.
Das Denken: Wir alle führen fast ständig innere Selbstgespräche, wir gehen morgens beim Zähneputzen den Tag durch und kommentieren ihn („Ach, das schon wieder“), in einer Pause sinnen wir über die Aussage eines Kollegen nach („Was meinte er wohl damit?“) oder wir planen Aktivitäten („Soll ich erst Einkaufen, und dann Rasenmähen?“)
Das Fühlen: Wir freuen uns über den Sieg unserer Fußballmannschaft, wir machen uns Sorgen, ob unser Partner gut zu Hause ankommt, wir ärgern uns über eine Autofahrer, der uns dreist die Vorfahrt genommen hat.
Das Verhalten: Wenn wir uns ärgern, können wir den Ärger unterdrücken oder lauthals äußern. Bei Trauer können wir den Tränen freien Lauf lassen oder uns ablenken. Auch Freude können wir offen zeigen oder im Stillen genießen. Wenn wir erschöpft sind, können wir eine Pause einlegen, einen Moment ausruhen. Doch oft kommen dann Gedanken: `Du wolltest doch noch dies und jenes tun´- also runter vom Sofa und aktiv werden.
Letzteres Beispiel macht deutlich, dass unser Denken, Fühlen und Verhalten eng miteinander verbunden sind. Und darüber hinaus sind wir noch mit unserer sozialen Umwelt verbunden, welche unser Denken, Fühlen und Verhalten ebenfalls mit beeinflussen kann.
Im Normalfall läuft das alles mehr oder weniger unbewusst ab, wir müssen uns nicht großartig darum kümmern, können uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das macht das Leben einfacher, denn die `Psyche´, unser Großrechner im Kopf, sorgt dafür, dass alles einigermaßen im Lot bleibt. Bei unerwarteten Ereignissen wie Krankheiten, Unfällen oder Verlusterlebnissen geraten wir jedoch aus dem Lot und erleben ganz neue Gedanken und Gefühle. Nichts ist mehr, wie es ist und wir müssen uns auf die neue Situation einstellen.
(Weiterführend Literatur: Knaurs moderne Psychologie von Heiner Legewie und Wolfram Ehlers, Verlag Droemer Knaur (1995)
Psychische Reaktionen auf eine Amputation
„Das erste Mal hatte Grace an Selbstmord gedacht, als sie im Taxi saß und von der Orthopädietechnikerin nach Hause fuhr. Der Schaft ihres künstlichen Beins bohrte sich in die Unterseite ihres Schenkelknochens, aber sie tat, als wäre alles in Ordnung und stimmte in die entschlossene Fröhlichkeit ihres Vaters ein, während sie überlegte, wie sie es am besten anstellen sollte. … Daß ihr Leben zerstört war, entsprach einer schlichten Tatsache, die das fieberhafte Bemühen von Freunden und Familie, sie vom Gegenteil überzeugen zu wollen, nur noch bekräftigte. Doch als die Wochen vergingen, begriff sie, beinahe mit einer gewissen Enttäuschung, daß sie nicht zu der Sorte Mensch gehöre, die Selbstmord beging“
(aus Evans: Der Pferdeflüsterer)
Die Amputation eines Beines oder eines Armes ist so ein außergewöhnliches Ereignis, welches unser Denken, Fühlen und Verhalten im wahrsten Sinne des Wortes einschneidend verändert. Die Psychologische Forschung zur Stress- und Krankheitsbewältigung hat den Nachweis erbracht, daß Menschen verschiedene Phasen durchlaufen, um ein physisch oder psychisch extrem belastendes Ereignis (Trauma) zu verarbeiten. Zusammengefasst sind dies drei unterschiedliche Phasen:
1. Phase der Abwehr
Die Reaktionen in dieser Phase sind dadurch gekennzeichnet, dass das belastende Ereignis mehr oder weniger bewußt verdrängt oder auch verleugnet wird („Das ist ja unglaublich, kann nicht wahr sein“). Gefühle treten in dieser Phase so gut wie kaum auf, die Betroffenen fühlen sich wie betäubt. Psychologisch ist dieses Verhalten durchaus sinnvoll, da es vor psychischer Überforderung bzw. Überlastung schützt.
2. Phase der Konfrontation
In dieser Phase wird uns die neue Situation in voller Tragweite bewusst. “Was wird aus mir?” “Wie soll es weitergehen?” “Bin ja gar kein richtiger Mann/keine richtige Frau mehr!” sind Reaktionen auf der gedanklichen Ebene. Oft treten vollkommen unvermittelt Gefühle der Trauer, der Angst, der Panik aber auch der Wut auf (“Manchmal ist mir einfach zum Heulen zumute, ich weiß gar nicht warum”) . All diese Gefühle sind normal und nützlich: Sie fördern den Trauerprozess (Wir haben ein Teil unseres Körpers verloren) und bereiten uns auf die neue Lebenssituation vor. Eine erfolgreiche Anpassung erfolgt letztlich auf der gedanklichen Ebene, besser gesagt, auf der Einstellungsebene. Dabei geht es darum, persönliche Antworten auf die Fragen „wie konnte das passieren?“ (Verstehbarkeit), „wie soll es nur weitergehen“ (Bewältigbarkeit) und „warum musste gerade mir das passieren?“ (Sinngebung) zu finden.
3. Phase der Akzeptanz
Der Betroffene hat sich mit seiner Situation arrangiert, ein neues Selbstwertgefühl entwickelt und einen Platz in Familie, Beruf und Gesellschaft gefunden.
Wichtig ist, dass diese Phasen nicht in strenger chronologischer Reihenfolge durchlaufen werden, sondern – je nach Lebenssituation und den akuten psychosozialen Belastungen – durchaus mehrfach auftreten können. Insbesondere die Amputationsursache kann die Reaktion des Betroffenen deutlich beeinflussen:
Nach einer Amputation infolge eines Unfalls ist der Betroffene zunächst unter Schock. Wenn er dann die Tragweite der Verletzungen bzw. die sozialen und beruflichen Folgen begreift, können heftige gefühlsmäßige Reaktionen auftreten, die er – je nach seinem Verhaltensstil- entweder unterdrückt oder auslebt. Ist die Amputation jedoch das Ergebnis einer längeren schmerzhaften Krankheitsphase, ist die neue Situation insbesondere aufgrund der damit verbundenen Schmerzfreiheit häufig wie eine Erlösung.
Auch das Idealbild einer vollkommenen Akzeptanz der Behinderung muss für die Betroffenen selbst nicht von Vorteil sein. Damit ist nämlich die Gefahr verbunden, sich vorwiegend über die Behinderung zu definieren (`Ich bin ein Behinderter´). Zuallererst sind wir aber Menschen und allein dadurch wertvoll. Unsere Grenzen und Einschränkungen kommen erst an zweiter Stelle. Die Anpassung an eine neue Lebenssituation ist immer wieder mit Rückschlägen, Schwierigkeiten und somit auch mit emotionalen Krisen verbunden. Gelingt es, trotz dieses Auf und Ab ein stabiles Selbstwertgefühl zu entwickeln bzw. ein Gefühl für die eigene Würde zu entdecken, kann am ehesten von einer gelungenen Anpassung gesprochen werden.
Psychische Risikofaktoren
So wie Rauchen, Bewegungsmangel und schlechte Ernährung das Risiko für Herz-/Kreislauerkrankungen erhöhen, konnten in einer Reihe von Studien psychische und soziale Risikofaktoren für einen schlechte Anpassung nach Amputation ausfindig gemacht werden. Im Einzelnen sind dies
Fehlende Akzeptanz der Amputation: Wenn die Betroffenen die Amputation und die damit entstandene Situation leugnen, abwehren, manchmal einen übertriebenen Optimismus zur Schau stellen und damit die Schwierigkeiten leugnen.
Pessimismus: Die Schwierigkeiten werden übertrieben, die noch vorhandenen Fähigkeiten ausgeblendet, die eigene Person abgewertet (“Bin doch ein Krüppel jetzt”). Es bildet sich ein trübsinniges und niedergeschlagenes Lebensgefühl.
Passiver Problemlösestil: Die Lösung medizinischer, sozialer und finanzieller Angelegenheiten wird komplett in die Hände entsprechender Fachleute gelegt oder an Angehörige abgegeben.
Introvertiertheit: Die eigene Gedanken- und Gefühlswelt wird vorwiegend für sich behalten. Die Gedanken drehen sich im Kreis. Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung entstehen. Trotz Vorhandensein eines Partners oder einer Partnerin fühlt der Betroffene sich allein mit seinen Sorgen und Ängsten.
Fehlen einer Vertrauensperson: Es fehlt die Bindung zu einer Person, der man alles, auch die intimsten Sorgen und Nöte, mitteilen kann. Auch Betroffene, die in Ehen oder Partnerschaften leben, können sich allein fühlen, wenn es nicht gelingt, die innere Gefühlswelt dem anderen mitzuteilen.
Desinteresse an Sport: Mit einer Beinprothese laufen zu lernen, ist ein sportliche Aufgabe. Menschen, die Spaß daran haben, neue Möglichkeiten des Körpers auszuprobieren und dies als Herausforderung ansehen, sind eindeutig in Vorteil.
Wichtig ist: Wenn ich mich als Betroffener mal zurückziehe, andere machen lasse, die Schwierigkeiten übertreibe, niedergeschlagen bin, bedeutet das nicht automatisch ein höheres Risiko für eine ungünstige Anpassung. Bei der Betrachtung des Phasenmodells haben wir gesehen, dass die einzelnen Denk-, Gefühls- und Verhaltensweisen ihren Sinn haben und sich dynamisch abwechseln können. Problematisch wird es in der Regel dann, wenn der Betroffene mit einem festgefahrenen Muster reagiert (Entweder ausschließlich Rückzug, Passivität oder aber auch übertriebene Aktivität).
Möglichkeiten der Selbsthilfe
In der Akutklinik:
Für Betroffene: Konfrontieren sie sich nach der Amputation behutsam mit der neuen körperlichen Situation: Den Stumpf das erste Mal ggf. in Anwesenheit einer Vertrauensperson betrachten (Partner, Krankenschwester, Physiotherapeut, Seelsorger). Sollte ihr Kopf `leer´ sein und sie empfinden so gut wie nichts, ist das in Ordnung. Wenn aus dem Nichts heraus Tränen und Traurigkeit aufsteigen, ist das ganz natürlich und gesund. Sie trauern um ihren Körperteil. Möchten Sie mit ihrer Trauer nicht alleine sein, ihre Angehörigen aber auch nicht damit belasten, verlangen sie nach einem Seelsorger, einem Besuchsdienst (meist ehrenamtliche Kräfte, die speziell geschult sind, Menschen in Krisensituationen beizustehen) oder fragen nach der örtlichen Selbsthilfegruppe für Amputierte.
Für Angehörige: Versuchen Sie, eine Balance zwischen Normalität (Phase der Abwehr) und mitfühlender Begleitung (Konfrontation) herzustellen. Reden Sie mit dem Betroffenen über den normalen Alltag in der Familie, Freundeskreis und Beruf, lassen ihn aber auch trauern, wenn ihm danach zumute ist.
In der Rehaklinik
Für Betroffene: Suchen Sie den Kontakt zu ebenfalls betroffenen Mitpatienten, insbesondere zu solchen, die ihnen Mut machen und Hoffnung einflössen. Manche Reha-Kliniken haben spezielle Angebote zur Krankheitsbewältigung für Menschen mit Amputationen. Bestimmen Sie mit ihrem Arzt ein konkretes und realistisches Ziel (z.B.: An zwei Unterarmgehstützen mit der Prothese gehen können). Stecken Sie sich darüber hinaus ein persönliches Fernziel. (z.B. “Weihnachten werde ich wieder tanzen, ich sage nicht, welches Weihnachten”) Gestalten Sie den Reha-Aufenthalt aktiv, indem Sie möglichst viel nachfragen, Informationen einholen und Kontakte herstellen. Bei manchen Betroffenen kommen erst in der Reha-Klinik Gefühle wie Ängste, Trauer oder Wut hoch. Scheuen Sie sich nicht, Kontakt zu einem Psychologen aufzunehmen. Meisten können ein bis zwei Gespräche eine große Entlastung bewirken. Ebenfalls wichtig ist, dass Sie sich gegen Ende des Aufenthaltes auf die Zeit zu Hause vorbereiten.
Für Angehörige: In der Akutklinik war der Betroffene noch auf ihre Hilfe angewiesen, jetzt kann er mehr und mehr selber machen. Wenn Sie zu übertriebener Hilfe neigen, sollten Sie sich zurückhalten. Wichtig kann es auch sein, sich darüber zu verständigen, wann der Betroffene Hilfe braucht und wann eher Eigenständigkeit.
Im häuslichen Umfeld:
Für Betroffene: In der Reha-Klinik fühlten Sie sich in einer sicheren Umgebung, wie unter einer Glocke. Im häuslichen Umfeld sind Sie dagegen mehr auf sich allein gestellt. Wichtig ist, möglichst bald zu einem geregelten Tagesablauf zurückzukehren, bestimmte Aufgaben im Haushalt zu übernehmen, in der Reha erlernte Übungen fortzuführen. Wichtig für das Selbstwertgefühl ist es, Aktivitäten aufzunehmen, die ihnen Spaß machen (z.B. Sport, Hobby) oder mit denen sie sich für andere nützlich machen (Betreuung von Enkelkindern, ehrenamtliche Tätigkeit in einem Verein). Auch kann es hilfreich sein, den Kontakt zu einer Amputierten-Selbsthilfegruppe aufzunehmen. Die Anpassung an die neue Lebenssituation hängt sehr von der Persönlichkeit des Betroffenen ab: Wie offensiv jemand im Alltag mit seiner Behinderung umgeht (“Im Urlaub gehe ich erstmal mit der Prothese am Strand auf und ab, bis die Leute sich satt gesehen haben“), ist in hohem Maße abhängig von seiner Grundpersönlichkeit. Wie bei der Gangschule sollte jeder seinen eigenen, ganz persönlichen Weg gehen, jeder in seinem Tempo. Wichtig ist nur, dass man auf dem Weg ist.
Für Angehörige: Wenn Sie feststellen, dass der Betroffene langsam wieder `der Alte´ wird, ist alles ok. Sollte er dagegen ungewohnt passiv, still und zurückhaltend sein, dann fragen Sie mal behutsam nach, was ihn belastet. Eventuell können Sie ihn unterstützen, den Kontakt zu einer Sport-, Selbsthilfe-, oder sonstigen Gruppe herzustellen.
Eine erfolgreiche Bewältigung der neuen Lebenssituation ist nicht das Ausbleiben von Krisen, Schwierigkeiten, Ängsten, Zweifeln, sondern es ist die durch Lebenserfahrung gewonnene Einstellung, dass die Amputation keine Katastrophe, sondern eine Herausforderung für das Leben darstellt. “Allzeit fröhlich ist gefährlich, allzeit traurig ist beschwerlich, allzeit glücklich ist unmöglich, eins ums andere ist vergnüglich” (Spruch auf einem Bauernhaus aus dem 18. Jht.)
Stephan Panning
Diplompsychologe / Psychotherapeut
Seit 1995 begleitende Betreuung und Behandlung von Menschen mit Amputationen im RehaKlinikum Bad Rothenfelde Klinik Münsterland. Stephan.Panning@drv-westfalen.de
Tel.: 05424-2200

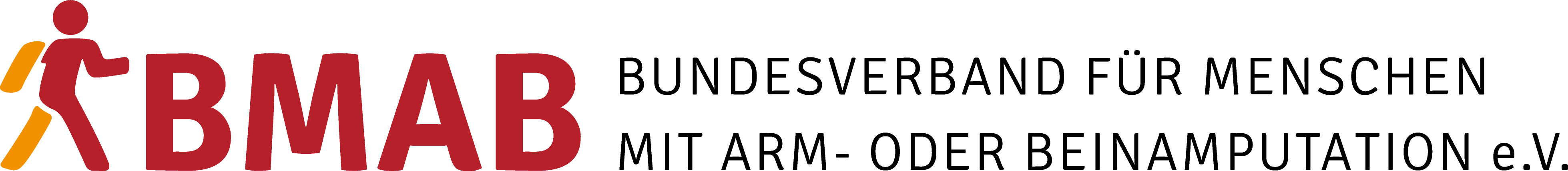


Comments are closed.